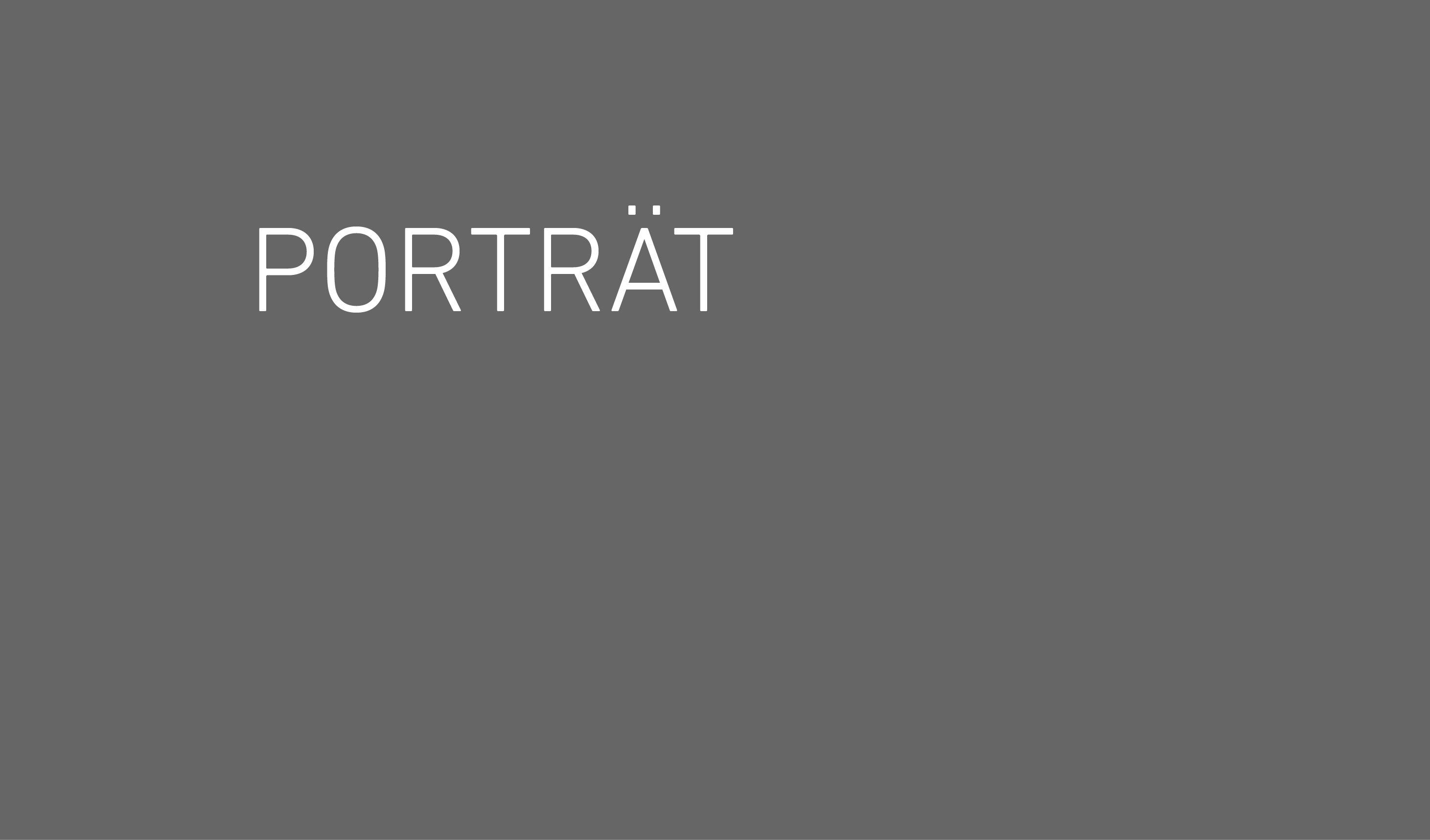Zacken Nummer 47
Jacob Miller ist mein Name. Ich habe meine besten Jahre bereits hinter mir, obwohl ich mich eigentlich an kein sonderlich gutes Jahr erinnern kann. Das schüttere Haar auf meinem Kopf weist erste graue Zonen auf, meist untermalen dunkle Augenringe meine sonst eher unauffälligen graublauen Augen und in der Mitte meines Gesichts sitzt eine etwas zu gross geratene Nase. Doch im Grunde genommen spielt das alles gar keine Rolle. Denn hier und jetzt bin ich nichts weiter als eine Nummer. Eine Nummer ohne Gesicht, ohne Geschichte und ohne Gefühle. Ich bin Nummer 47. Nicht einmal eine gute Nummer, wenn wir ehrlich sind. In der Akte 47 stehen Dinge wie «ledig», «kinderlos», und so weiter. Vielleicht steht da aber auch nur «Arbeitsplatz Nummer 47, Name: Jacob Miller.»
Ich weiss es nicht, denn was weiss ich schon? Ich bin nur ein Zahnrad einer grossen Bürokratie, ach nein, was rede ich hier, ein kleiner Zacken eines Zahnrades, das man mühelos mit irgendeinem anderen ersetzen könnte – eben, Zacken Nummer 47. Die Firma würde auch ohne mich bestens funktionieren. Ich weiss das, meine Mitarbeiter wissen das und mein Vorgesetzter weiss das nur zu gut. Denn er gibt mir gerade in diesem Moment mehr als deutlich zu verstehen, dass ich für ihn nur der letzte Abschaum bin. Natürlich in einer Lautstärke, die selbst in der hintersten Ecke des Grossraumbüros zu vernehmen ist. Ich spüre die schadenfreudigen Blicke meiner sogenannten Arbeitskollegen in meinem Nacken und höre das Gekicher der Bürozicken, die sich jedesmal köstlich über mein Versagen amüsieren. Mit zittriger Hand wische ich mir die Schweissperlen von der Stirn und stammle einen ersten Erklärungsversuch. Er fällt mir ins Wort. Ich versuche mich zu verteidigen. Er wird nur noch aggressiver. Also endet es, wie es immer endet. Ich entschuldige mich kleinlaut. Das einzige, was er zulässt. Kriechen, um Gnade flehen. Ich murmle etwas wie: «das wird nicht wieder vorkommen.» Wir beide wussten schon von Anfang an, dass dieses Gespräch so enden würde. Mit breitem Grinsen im Gesicht und den Worten: «Das bezweifle ich!» verlässt er meinen Arbeitsplatz wieder. Mein Blick wandert hektisch über die amüsierten Gesichter im Raum, die ohne es zu verbergen, gespannt abwarten, wie meine Reaktion ausfallen würde.
Es wäre nicht das erste Mal, dass ich nach einem solchen Vorfall den Raum völlig überstürzt, mit hochrotem Kopf verlasse, während die erste dicke Träne meine Wange herunterkullert. Ja, werter Leser, sprich nur aus, was du gerade denkst. Ich bin ein Loser. Sogar ich selber weiss das. Aber heute reagiere ich gefasst. Diesen Triumph wollte ich ihnen nicht gönnen. Ich schlucke einmal leer, drehe meinen Stuhl wieder in Richtung des Computers und starre apathisch in den Bildschirm. Versuche jeden meiner Gedanken auf das Flimmern zu konzen-trieren. Meine Gefühle auf diese Maschine zu kanalisieren, um den über längere Zeit unvermeidbare Nervenzusammenbruch hinauszuschieben.
Ich weiss nicht, wie lange ich den Computer in dieser hypnotisierenden Weise angestarrt habe, aber irgendwann muss wohl der erlösende Feierabend gekommen sein und irgendwie muss ich dem Bürokomplex offenbar entkommen sein. Jetzt sitze ich in der U-Bahn und starre genauso apathisch aus dem Fenster, obwohl hinter der Scheibe nur die Schwärze des New Yorker Untergrunds zu sehen ist.
Zuhause wartet Molly auf mich. Eine treue Seele, die für meine Sorgen immer ein offenes Ohr hat. Wobei Ohr vielleicht das falsche Wort ist, Schildkröten haben schliesslich keine richtigen Ohren… nur zwei Löcher im Kopf… und einen Gehörgang, aber egal… Zur Begrüssung reckt sie ihren faltigen Hals in meine Richtung und guckt einschläfernd durch die matte Scheibe ihres Terrariums. Ich strecke meine Hand hinein und warte, bis sie nach einer gefühlten Stunde auf sie gekrochen ist. «Molly, ich konnte es nicht tun…» «Feigling!» krächzt das Runzelgesicht. «Es war nicht der richtige Zeitpunkt…» «Ausrede!» «Das ganze ist nicht so einfach…» «Du hast nur Angst!» widerspricht sie, «Nein…» Ich meine ein siegesgewisses Lächeln auf dem Schildkrötenmund zu erkennen, «morgen ist auch noch ein Tag!» tröstet sie mich «Ja, morgen…»
Ich ziehe den Vorhang zu. Alles, was ich will, ist alleine sein. Diese dämlichen Visagen aus meiner Erinnerung löschen. Doch mit der Dunkelheit kommen auch die verdrängten Gesichter wieder zum Vorschein und in meinem Traum sind ihre Grimassen noch verzerrter. Das Grinsen zieht sich bis zu den Ohren rauf. Das Lachen klingt noch hysterischer und der Schmerz Tief in der Brust ist noch unerträglicher. Ich sehe mich, wie ich die unterste Schublade meines Bürokorpus öffne, hineingreife und meine Waffe hervorhole. Die schadenfreudigen Blicke weichen plötzlich einem angsterfüllten, panischen Ausdruck. Und ich spüre das befreiende Gefühl, ihnen einem nach dem anderen die Visage zu zerfetzen. Schuss für Schuss fühle ich endlich das Gefühl der Macht, Freiheit und Respekt. Ich höre ein schallendes Lachen und erkenn den Klang meiner eigenen Stimme kaum wieder. Zu lange schon hatte ich keinen Grund mehr zu lachen.
Als mein Traum jäh durch den klingenden Wecker unterbrochen wird kann ich es ganz genau fühlen: Ich bin soweit. Heute werde ich es tun. Die Gestalt die vor mir im Badezimmer-spiegel steht macht einen erbärmlichen Eindruck. Bin das wirklich ich? Ich war schon immer etwas pummelig. Bereits in der Grundschule wurde ich deswegen gehänselt. Ich hatte die gemeinen Streiche, die fiesen Sprüche und Sticheleien nur deshalb ertragen, weil ich immer geglaubt habe, dass es eines Tages besser werden würde. Ich dachte, unter Erwachsenen würde man sich mit Respekt begegnen. Doch offensichtlich hatte ich mich getäuscht.
Mit dem Blick in den Spiegel schwindet mein Mut wieder. Ich komme mir lächerlich vor. Wie sollte so eine Witzfigur wie ich jemandem Respekt einflössen können? Auf dem Weg zum Büro ist von der anfänglichen Entschlossenheit nichts mehr übrig. In der U-Bahn höre ich die Leute hinter meinem Rücken kichern. Bestimmt machen sie sich über mich lustig. Über meine pummelige Gestalt oder die altmodische Kleidung, meine Halbglatze oder die dicke Hornbrille… es gibt genug, worüber sie sich amüsieren könnten. Auf der Strasse habe ich das Gefühl, dass die Leute mir verachtende Blicke zuwerfen. Manche lachen beim Vorbeigehen -bestimmt über mich. Fast schon bin ich froh, den Ort des Schreckens – mein Büro – endlich zu erreichen.
Mit hängenden Schultern schlurfe ich so unauffällig es eben geht durch die Gänge. Kurz vor meinem Arbeitsplatz stolpere ich. War ich über meine eigenen Füsse gestolpert, oder hat mir jemand das Bein gestellt? Ich rapple mich auf und verkriech mich so schnell es geht hinter meinem Bildschirm. Ich sollte es tun… jetzt! Mein Blick schweift zu der verheissungsvollen Schublade. Das ist der einzige Ausweg, da bin ich mir sicher. Langsam öffne ich die Schublade. Mit zittriger Hand und nicht halb so entschlossen wie in meinem Traum greife ich nach der Waffe.
Ein lauter Knall durchbricht das monotone Geräusch der surrenden PCs. Jemand schreit. Panik bricht aus. Ein zweiter Schuss fällt. Ich starre auf die Waffe in meiner Hand – sie ist unbenutzt. Träume ich? Ein weiterer Schuss fällt. Vor meinen Augen bricht mein Chef mit einem grossen Loch im Kopf zusammen. Nein, das ist kein Traum. Das hier passierte wirklich. Ich schlucke einmal leer und erhebe mich langsam, um einen Blick über die Trennwand zu wagen. Am Eingang steht er. Ich habe ihn schon ein par Mal gesehen, er ist mir jedoch nie wirklich aufgefallen. Ich glaube, er verteilt die interne Post unter den Mitarbeitern…
Sein Gesicht wirkt teilnahmslos als er die Sekretärin, die bereits wimmernd am Boden liegt abknallt. Langsam kehrt Stille ein. Wer nicht fliehen konnte, lag am Boden. Tot oder zumindest schwer verletzt. Er kommt auf mich zu. In meiner Hand halte ich noch immer die Waffe. Er kann sie nicht sehen, da die Trennwand zwischen uns steht. Er sieht mich an und senkt die Waffe. Meine Stimme ist nicht mehr als ein Flüstern: «Wieso hast du das getan?» «Das fragst gerade du?» Er schweigt einen Moment und mustert mich mitleidig, «ich hatte es satt… all die Sticheleien, die miesen Sprüche, die schadenfreudigen Blicke…» ich schlucke leer und starre ihn ungläubig an. Das hätten genauso gut meine Worte sein können. Und dennoch kann ich kein Verständnis für ihn aufbringen, seine Reaktion war einfach… irgendwie falsch… hatte ich nicht noch vor wenigen Augenblicken das selbe vorgehabt? Unvorstellbar. Er unterbricht meine Gedanken: «Keine Angst, dich werde ich nicht töten. Du bist die einzige Witzfigur in diesem Unternehmen, die noch erbärmlicher dran ist als ich.» «Erbärmlicher als du? Du verteilst die Post…» «Vielleicht solltest du etwas aufpassen, wie du mit dem Mann mit der Waffe in der Hand sprichst, du Vollidiot!» Meint er und unterstreicht seine Drohung indem er die Waffe wieder auf mich richtet. «Das selbe könnte ich auch zu dir sagen…» wieder wird die Stille von einem Knall durchbrochen. Das erwartete Gefühl von Macht oder Freiheit bleibt aus. Ich fühlte nur Mitleid und Schuld, als ich ihn leblos zu Boden sacken sehe.
Als ich das Büro nach der angeordneten Auszeit wieder betrete begrüssen mich meine Arbeitskollegen überschwenglich. Dass in mir ein wahrer Held stecke, hätten sie schon immer gewusst.
Natalie Achermann (August 2011)